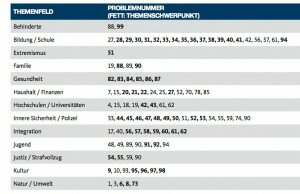I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone, if possible, Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness — not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another.
In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost.
The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world — millions of despairing men, women and little children — victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say — do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed — the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people and so long as men die, liberty will never perish.
Soldiers! Don’t give yourselves to brutes — men who despise you — enslave you — who regiment your lives — tell you what to do — what to think or what to feel! Who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men — machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts. You don’t hate! Only the unloved hate — the unloved and the unnatural!
Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty! In the 17th Chapter of St. Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” — not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power — the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.
Then, in the name of democracy, let us use that power! Let us all unite! Let us fight for a new world, a decent world that will give men a chance to work, that will give youth the future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power, but they lie! They do not fulfill their promise; they never will. Dictators free themselves, but they enslave the people! Now, let us fight to fulfill that promise! Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.
Soldiers! In the name of democracy, let us all unite!
Politik
5
Dez 11
Ihr seid Menschen
18
Nov 11
Gefühlte Zeit: 1929
Ich bin meistens ratlos. Sollte man als Kolumnist nicht sein, aber gerade den jüngeren Lesern kann ich versichern: Ratlosigkeit nimmt mit dem Alter zu (außer bei Helmut Schmidt).
Ein Ratlosigkeitsgipfel ist bei mir in diesem Jahr erreicht. Ich verstehe die Finanzkrise nicht, ich habe keine Ahnung, was die europäischen Staaten da tun sollten, ich verstehe Anonymous nicht und ich hoffe immer wieder kurz, Occupy zu verstehen, aber dann ist der Moment der Erkenntnis und des Verstehens auch schon wieder vorbei.
Ich verstehe braunen Terror nicht. Es gibt Psychopathen, in Ordnung, aber dass Psychopathen Anhänger haben, erschließt sich mir nicht. Ich finde auch tatsächlich den Gedanken schwierig, dass jemand Bilder von Auschwitz sieht und mit denen auf der sicheren Seite des Zauns sympathisiert. Ich verstehe aber auch nicht, was ein Verfassungsschutz so macht.
Das Wesen der Demokratie ist ja nun einmal Transparenz und Mehrheitsentscheidung, nicht Geheimnis und klandestine Autorität.
Wenn jemand aus Gründen der Tarnung den Nazi gibt – ab wann ist er einer geworden?
Und warum eigentlich fällt es so schwer, um Menschen zu trauern, deren Großeltern nicht zusammen mit unseren Großeltern eines dieser Konzentrationslager betrieben haben? Es gehe nicht um Gesten der Anteilnahme, sagt die baden-württembergische Integrationsministerin im Interview mit Spiegel Online. Geht es nicht bei Trauer immer genau darum?
Manchmal möchte man gar nicht nach vorne schauen.
Ich jedenfalls möchte das nicht. Ich würde gern kurz mal stehenbleiben und mich sortieren.
29
Okt 11
Im Herzen die Weißeste von Allen
Die Autorin Noah Sow wurde zu einer Lesung in Fulda eingeladen. Die Organisatorin, Mitglied in der Grünen Jugend und von Sow als im “antifaesken Look”gekleidet geschildert, versteht die Abkürzung PoC nicht und reagiert auf die Empörung, die Sow äußert, als diese in dem Café, in dem gelesen werden soll, eine (in der Tat geschmacklose) Mohrenfigur sieht, mit den Worten: “Das können wir doch lösen. Ich kannte ja das Café vorher gar nicht.”
(Ein Bild des Mohren ist verlinkt in Sows Blog mit den Worten “Achtung; Bild nicht gewaltfrei”).
Sow weigert sich daraufhin, die Lesung zu absolvieren. Über diesen Skandal berichtet die Feministin und Bloggerin (Mädchenmannschaft) Nadine Lantzsch. In einem offenen Brief an die Veranstalter schreibt sie:
“Ich bin entsetzt darüber, dass Sie die Dreistigkeit besitzen, eine PoC in einen weißen Raum einzuladen, in dem sie es sich neben kolonialrassistischen “Raumverschöner_innen” gemütlich machen und ein (wahrscheinlich) mehrheitlich weißes Publikum darüber aufklären soll, was Rassismus ist. Das bodenlose Fass könnte nicht größer sein, wird leider aber noch übertroffen von den gewaltvollen wie übergriffigen Reaktionen und der Supremacy-Haltung, denen sich Noah Sow bei Betreten des Raumes in Gegenwart einer der weißen Organisator_innen ausgesetzt sah.”
Das schlägt der Fäss_in doch die Böd_in aus! Die Reaktion der jungen Grünen war ein gewaltvoller Übergriff, nein Entschuldigung: eine Übergriff_in!
Wer ist der bessere Mensch in diesem titanischen Kampf der politisch korrekten Geisteselite: Antifa-Frau oder PoC-Schriftstellerin, linker ASTA oder die Feministin?
Im März 2009 war Nadine Lantzsch bei mir zu Besuch und wir haben gemeinsam einen Podcast gemacht.
Im Vorgespräch hatte sie gesagt, sie würde sich gern “über Linke aufregen”. Während des Podcasts sagte sie dann auf die Frage, was sie denn gegen Linke habe: “Ich finde die irgendwie hohl. Ich weiß auch nicht.” (etwa ab Minute 9)
Linkssein definierte Lantzsch im Folgenden als “Steinewerfen für den Weltfrieden”, was sie “irgendwie diffus” fand.
Sie beklagte dann, dass Linke sich in jede Form von Protest hineindrängen und die Ziele dieses Protests damit deligitimieren würden, denn: “Deren Ziele sind so weit weg von der Realität, dass man damit niemals die bürgerliche Mitte erreichen kann, die dann wirklich was ändern kann.”
So weit, so irgendwie. Es war ein irgendwie diffuser Podcast mit einer irgendwie diffus unpolitischen jungen Frau, die halt in erster Linie jung war.
Heute allerdings ist Nadine Lantzsch hochsensibilisiert. Ihr innerer Geigerzähler schlägt nicht nur bei subtilsten Sexismen zuverlässig aus, auch für Rassismus ist sie innerhalb der vergangenen zwei Jahre durch ihr Studium der Gender- und Diversitiy-Kompetenz Expertin geworden.
Man kann in zwei Jahren zweifelsohne eine Menge lernen, und nichts, was sie heute schreibt, ist allein schon dadurch diskreditiert, dass sie vor zwei Jahren eine reine Tor_in war. Und doch ist der Konvertitenfuror das, was ihre Texte so unerträglich macht. Es gibt in ihrem Denken keine Gelassenheit, keine Freundlichkeit, keinen nach vorne gerichteten Enthusisasmus. Alles ist Häme, jedes Wort ein nach oben gereckter Arm, der dem Mitschüler signalisiert: “Ich weiß was. Und du nicht.”
Da lädt jemand eine Autorin ein, hat das Café, in dem gelesen wird, vorher nicht untersucht, und kennt die Abkürzung des in Deutschland nicht besonders üblichen Begriffs People of Color nicht: und wird dafür hingestellt, als hätte sie das Dritte Reich mit Gaskammern beliefert.
Das ist ein Ichbinbesseralsdu-Wettbewerb, bei dem ich kotzen muss. Ich habe halt einen Privilegienpenis und bin weiß wie Schnee. Aber so weiß wie Lantzsch im Herzen ist, das werde ich wohl nicht mehr werden.
UPDATE:
Cigar Store Indian von Seinfeld muss da natürlich erwähnt werden.
20
Okt 11
Das Originalskript der Rede von Hans-Peter Uhl (Auszug)
Das Land wird mit Sicherheit von Beamten regiert, ja gut – und da wissen wir ja alle, dass da nicht immer sooo genau hingesehen wird.
(Lachen abwarten)
Aber wo bleibt das Menschliche?
(unter Umständen hier Metapher einfügen)
Der Verkehr wird von Ampeln geregelt, im Flugzeug haben die Bitte-Anschnallen-Leuchten das Sagen, im Staudamm der Stau ….
(Lachen abwarten)
im Meer die Bojen und in Bayern halt das Landratsamt Oberschaffenhausen,
(hier ruhig etwas Verve), ja Kruzifixtürken, wenn der Hoeneß beim FC den Balljungen ins Tor stellen tät, dann tät da halt der Balljunge halten.
Und wie wir den Hoeneß kennen, er tät das auch ganz ordentlich machen, ja seien wir doch mal ehrlich.
Im Internet, da wurde vor kurzem einer alten Frau ihr Pudel gestohlen! Ihr Pudel!
Soll da der Kriminalobermeister sagen: „Ja schön, gnädige Frau“ (obwohl sie natürlich a Trutschn is, a leidige, aber in Bayern hat man eben noch einen Anstand – (vielleicht aufheben fürs Bierzelt)), aber da kaufen Sie sich wohl besser einen neuen Pudel, uns sind da die Hände gebunden, wegen die Piraten aus Berlin?“
Ja soll denn die Frau pudellos sterben wegen ein paar Chaoten aus einer Stadt, wo sowieso jeder auf die Straße macht, ob Hund oder Türkenkind?
Da haben ja nicht einmal die Ampeln alle Kameras.
Wenn Sie meine Damen und Herren, in Berlin vom Reichstag aus Richtung das Judendenkmal gehen, aber das ist vielleicht ein Slalom, da können Sie hier aber sauberer vom Flughafen, also wenn man das mal vergleicht von den Dimensionen, Berlin ist ja kaum viel größer, aber was den Dreck angeht, meine Mutter sagt immer: „Junge, bleib sauber“, aber da kann ich meine Mutter beruhigen: Ich hab nämlich gar kein Internet.
(Applaus abwarten, vielleicht verneigen)
(via)
9
Sep 11
Wählerverdrossenheit
Ich habe per Briefwahl gewählt. Und zwar Grün, Pirat, Pirat. Erststimme Grün, Zweitstimme Piraten, Bezirksdings ebenfalls Piraten. Schon mit der Drittstimme war ich ehrlich gesagt überfordert, weil ich nicht die geringste Ahnung hatte, ob es da nach Verhältnis- oder Mehrheitswahlrecht geht, ob es also überhaupt Sinn hat, eine Zwergpartei zu wählen.
Ich würde verstehen, wenn Politiker Wählerverdrossenheit hätten, denn mein eigener Bürgersinn war dieses Mal besonders unterentwickelt. Ich habe auf dem Wahlomaten durchgespielt, mit wessen Programm ich am ehesten übereinstimme und heraus kam: Grün, Linke, Piraten.
Allerdings habe ich bei ungefähr 60% aller Fragen gesagt, dass sie mir egal sind, bei 20% wusste ich beim besten Willen nicht, welche Lösung für mich, Berlin oder das Land am besten ist und dazu habe ich auch viel aus dem Bauch entschieden. Heraus kam also meine Herzenspartei, die Grünen, und eine, die ich recht herzhaft verabscheue, die Linke. Und dann noch die, die ich mit dem Bauch wähle. Abgeschlagen wie immer CDU und NPD, ohne dass ich die jetzt in einen Topf stecken wollen würde, das will ich tatsächlich nicht.
Ich weiß nicht einmal, warum die CDU so völlig abgeschlagen bei mir ist, wenn ich ihr Programm lese, wünschen die sich genauso wie ich weiße Weihnacht.
Na klar, es ist putzig, wenn man sich immer aufpumpt, man würde die Bürokratie abbauen und so, und dann sieht das eigene Wahlprogramm so aus:
Aber das ist es nicht, warum ich die CDU nicht wähle. Ohne dass sie oder ich es wüssten, scheinen wir in jedem Punkt unterschiedlicher Meinung zu sein, so als wären wir schon sehr lange sehr unglücklich verheiratet.
Was ich eigentlich sagen wollte: Mit 15 konnte ich noch besser Politik machen als der Bundeskanzler. Jetzt kann ich nicht mal sagen, wem die Berliner S-Bahn gehören soll. Berliner Politiker: Ich verstehe, wenn ihr enttäuscht seid von mir. Ich habe meinen Job nicht gemacht. Mit mir ist kein Staat zu machen.
Aber ich gebe ab jetzt mein Bestes. Wartet nicht drauf, aber: versprochen.
24
Aug 11
Club ohne Konsequenzen
Es gibt diesen Club, dessen Eingang kann überall sein.
Jeder kann rein.
Er ist riesig, unübersichtlich. Und doch kann man nicht verloren gehen.
Man hat dort Vergnügen ohne Ende. Und kommt niemals mit einem Kater raus.
Sex mit wem man will. Ohne Geschlechtskrankheiten.
Streit mit wem man will. Ohne blaues Auge.
Dieser Club macht glücklich, also sagen die Leute, er mache süchtig.
Aber nein, sagen die, die häufig da sind: “Als ich klein war, da konnte ich, wenn ich ein cleveres Kind war, Terra X schauen. Terra X, ich bitte Sie! Heute kann ich immerzu den klügsten Menschen der Welt lauschen. Ich höre von Regisseuren, wie sie ihre Filme erklären, Wissenschaftler zeigen mir ihre Studien im Original, ich muss sie mir nicht mehr von jemandem, der sie nicht verstanden hat, erzählen lassen – im Ernst, ich bin nicht süchtig: Ich bin hier gern.”
Neuerdings trifft man dauernd Leute, die man nicht mehr sehen wollte. Und selbst das ist toll. Auf einmal merkt man, dass die Leute viel netter sind, als man sie in Erinnerung hatte. Selbst der größte Vollidiot ist mit seiner Mutter da; und die ist eigentlich eine ganz anständige Frau.
Es sei da sehr gefährlich, sagen die Leute, die Angst brauchen.
Man müsse unterschiedlich viel Eintrittgeld verlangen, sagen die Leute, die mit dem Club Geld verdienen wollen.
Man müsse ein Namensschild tragen, sagen die Leute, die mit dem Club noch mehr Geld verdienen wollen.
Nö.
Nö
Nö.
Nennt mich ruhig konservativ. Ich will, dass der Club offen, frei und diskret bleibt. Was im Club passiert, bleibt im Club.
Die einzige Konsequenz ist, dass man klüger wird.
Eine schlechte Sache ist das nicht.
Deswegen wähle ich in Berlin die Piraten.
22
Aug 11
Programmraten für die Berlin-Wahl (Update: Auflösung)
Welche Partei sagt was in ihrem Programm? (Finger weg von Google!)
1) FDP
Wir wollen, dass jeder unbescholtene Bürger sich unbeobachtet im öffentlichen Raum bewegen kann. Eine diesbezügliche verdachts- und anlassunabhängige Überwachung lehnen wir daher ab.
Videoaufnahmen im öffentlichen Raum dürfen daher nur bei konkretem Verdacht einer Straftat dauerhaft gespeichert werden. Nur für die Aufklärung einer Straftat können die relevanten Aufnahmen der letzten Stunden durch technische Mittel gesichert werden (Quick-Freeze-Verfahren).
Eine Vorratsdatenspeicherung lehnen wir ab.
2) Die Grünen
Obwohl Berlin als weltoffene und tolerante Metropole gilt, sind Ausgrenzung, Diskriminierungen, Beleidigungen und auch Gewalt immer noch bittere Realität für Schwule, Lesben und Transgender. Noch viel zu viele Menschen können in der Öffentlichkeit, in Schulen oder bei der Arbeit ihre Identität nicht frei und offen zeigen, ohne Nachteile befürchten zu müssen.
3) CDU
Um homophobe Gewalt zu bekämpfen, ist es erforderlich, dass die Polizei die spezifischen Erscheinungsformen der Kriminalität gezielt erfasst und auch die Motivation der Täter ermittelt.
4) Die Grünen
Integrationsblockaden bestehen vor allem dort, wo sich soziale und rechtliche Ungleichheit, Bildungsarmut und Perspektivlosigkeit mit ethnischer Herkunft überlagern. Ausgrenzung und Abgrenzung verschärfen die Spaltung.
5) CDU
In Berlin leben etwa 872.000 Menschen mit Zuwanderungshintergrund. Viele von ihnen sind gut in das Leben unserer Stadt eingegliedert.
Sie leisten als Ärzte, Polizisten, Handwerker, Händler, Arbeitnehmer und Unternehmer einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer Stadt. Sie identifizieren sich mit Berlin und unserem Land. Sie fördern als ehrenamtlich Engagierte unser Gemeinwesen. Oftmals rückt ihre Integrationsleistung in der öffentlichen Debatte aber in den Hintergrund. Die Diskussion um Probleme im Bereich der Integration überschattet oftmals die Anerkennung der Erfolge.
4
Aug 11
Es gibt kein Milliardengeschäft mit Kinderpornographie
Vor einigen Wochen habe ich über mehrere Tage ein Interview mit einer heute erwachsenen Frau geführt, die zwischen ihrem zehnten und vierzehnten Lebensjahr von ihrem Onkel sexuell bedrängt worden ist. Die Verletzungen, die durch diese Übergriffe entstanden, sind auch nach Jahrzehnten noch nicht geheilt. Continue reading →
26
Jul 11
Liebe Schlechtmenschen
Um das mal vorweg zu nehmen: Ich war schon politisch unkorrekt, da habt ihr eurer Frau noch jedes Mal Blumen mitgebracht, wenn ihr im Puff wart.
Ihr seid nicht politisch unkorrekt, ihr Sarrazins, ihr PI-Nasen, ihr Maskulinisten und ihr Kreuz.net-Vollschreiber: Ihr seid intellektuell unkorrekt. Euer Denken ist haarscharf daneben und wenn ich sage haarscharf, dann meine ich: danebener als der Mond.
Die Welt ist arm und du bist reich.
Das macht dir Angst.
Die Welt ist bunt und du bist bleich.
Das macht dich neidisch.
Ihr seid nicht doof, ihr habt nur nie gelernt, euer Gehirn zu gebrauchen. Das erkennt man auf eine ganz einfache und harmlose Art: Ihr habt keinen Humor. Ihr könnt in der Regel Geld verdienen, ihr könnt Behördengänge absolvieren, ihr könnt pünktlich sein, und ihr konntet immer völlig in Ordnung eure Hausaufgaben machen.
Ihr seid die, die den Knall nicht gehört haben, ihr seid die, die sich wundern, warum plötzlich alle rennen.
Die rennen nicht, die tanzen.
Verehrte Zuspätgekommene, es ist 2011.
Deutschland bei der WM gerettet hat ein Muslim, im Team der ghanaischen Mannschaft stand der Bruder eines deutschen Verteidigers, und ja: Das ist nicht mehr das, womit wir aufgewachsen sind. Allerdings, Moment: Jimmy Hartwig war nun nicht so wahnsinnig reinrassig und Felix Magath, Psst, ist auch nur halb so deutsch wie alle denken.
Die Welt ist heute so offen unübersichtlich wie sie es immer schon im Verborgenen war.
Ihr seid die, die was leisten. Ihr seid die, die jede Menge Steuern zahlen, und dann kommen die Gutmenschen und verprassen das ganze schöne Geld.
Für Muslime!
Ihr wisst natürlich, dass eure Kinder nicht unter der Scharia aufwachsen werden, aber als Köder für die noch etwas ängstlicheren und noch etwas später gekommen unter euch funktioniert das ganz prächtig: Europa im Schatten von Moscheen, Schauder.
Wie Europa unter Schlechtmenschen aussähe, das könnt ihr euch jetzt anschauen, wenn ihr die Nachrichten anseht, ihr Hobby-Kreuzritter.
Wir hätten eine Gemeinschaft, wie sie immer schon war, wenn die Angst die Vernunft schlägt: Dann wird aufgeräumt, dann muss Blut fließen, dann wird man nicht mehr mal sagen dürfen, dann wird man sagen müssen: Sieg Heil, Deus lo vult!
Aufwachen.
Es wollen nicht alle euch etwas wegnehmen. Schaut mal, ihr bekommt sogar etwas: Tore bei der WM zum Beispiel. Ohne Özil wären wir, und ich schließe euch da ausnahmsweise ein, bei der WM in der Vorrunde ausgeschieden. Ohne Sarrazin hätten wir einfach nur weniger Altpapier.
Wer heute zehn kleine Türkenjungs gegen einen angstbeißenden Leister tauscht, gewinnt 2022 die WM.
Aber ich schweife ab: Was ich eigentlich sagen wollte, war. Schlaft mal aus, guckt mal die Blumen, geht zum Arzt und redet über eure schlaffen Pimmel, da gibt es heute ganz tolle Lösungen. Ladet eure Frau zum Essen ein beim teuersten Inder der Stadt und dann versucht mal richtig intensiv zu verstehen, dass alles gar nicht so schlimm ist. Solange man Leuten wie euch keinen Zugang zu Waffen gibt.
4
Jul 11
Auf der Autobahn des Irrsinns (Extended Version)
Bei taz.de habe ich einen Kommentar zu dem Sommerlochquatsch um Facebookpartys geschrieben.
Hier nun die Extended Version:
Unterdessen forderte Karl Theodor zu Guttenberg, der aus Kabinettssitzungen immer noch nicht wegzudenken ist, das Verbot von Druckern. Niemand könne vorhersagen, wann wo etwas ausgedruckt werde und wer die Druckergebnisse in die Hände bekomme. Überhaupt gebe es zuviel Druck. Weshalb man auch nie mit etwas fertig werde und überhaupt. Continue reading →