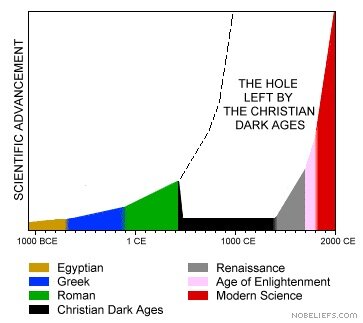Ich saß einmal im Zuschauerraum bei einem Vergewaltigungsprozess. Ich machte damals ein Praktikum im Aachener Sozialamt. Der Angeklagte war Sozialhilfeempfänger und der junge Beamte, dem ich zugeteilt war, als Zeuge geladen. In dem Prozess ging es auch noch um Sozialhilfebetrug und Schwarzfahren, man handelte eben alles, was bei dem Mann so angefallen war, in einem Rutsch ab.
Der Angeklagte war ein schlaksiger, nervöser Typ, vielleicht 22 Jahre alt, mit einem ungepflegten Schnauz. Er hatte das Äußere und auch die Haltung eines Befehlsempfängers, und doch wirkte er gefährlich wie ein in die Enge getriebener Hund.
Er sollte seine Ex-Freundin ans Bett gefesselt und dann oral, vaginal und anal vergewaltigt haben. Über den Prozesstag hinweg stellte sich heraus, dass es sich um eines dieser unglücklich miteinander verwobenen Paare handelte, bei dem der eine dem anderen zustößt wie eine Krankheit oder ein Unfall, und der andere es hinnimmt, weil er gerade sowieso nichts vorhatte mit seinem Leben. Mal hatte er ihr eine geknallt, mal hatte sie ihn zusammenschlagen lassen, mal hatte man sich zusammen betrunken, mal gegenseitig betrogen, mal einander benutzt, mal einander dann doch gebraucht.
Das schwere Amt des Richters
Die beste Freundin der Frau wurde vom Richter befragt, ob sie von der Vergewaltigung erfahren habe. Ja, sagte die beste Freundin, sie habe da mal von gehört, auf der Toilette habe die Frau es erzählt. Ob sie das geglaubt habe, fragte der Richter. Die beste Freundin zuckte mit den Schultern. „Weiß nicht.“
Am Ende konnte er sie nicht so gefesselt haben, wie sie es beschrieben hatte, es gab nämlich kein Bettgestell, nur eine Matratze, und so kam er frei.
Am nächsten Tag kam er entsprechend gut gelaunt ins Sozialamt, das Devote war gewichen, er war jetzt König der Welt. Er sagte uns, wir sollten mal, wenn wir das nächste Mal ausgingen, den Türstehern vom B9 seinen Namen nennen. Die würden sich einkacken. Er sei nämlich ein Austicker. Vielleicht sähe er nicht stark aus, aber wenn er austicke, dann gebe es kein Zurück. Er war ein Prachtexemplar von einem Menschen, man kann es nicht anders sagen.
Während des Prozesses hatte ich beschlossen, niemals Richter werden zu wollen. Entweder eine Vergewaltigung unbestraft lassen oder einen Unschuldigen wegsperren? Anhand von Aussagen von Zeugen, denen es gleichgültig war, ob ihre Freundin die Wahrheit sagte? Eine Welt beurteilen, in der Probleme sowieso mit den Fäusten geregelt wurden?
Keine Verurteilung für Kachelmann
Der Prozess um Jörg Kachelmann ist anders. Es soll geklärt werden, ob Kachelmann seine Ex-Freundin mit Gewalt und unter Einsatz eines Messers in der Nacht zum 9. Februar 2010 zum Geschlechtsverkehr gezwungen hat, wie sie es behauptet. Hier sind alle Beteiligten höchst eloquent, niemandem ist irgendetwas gleichgültig. Man ist klug und nervenstark und schlägt einander nur mit Erlaubnis. Und doch blickt man wieder als Außenstehender darauf und kann nichts beurteilen.
Was man ja auch nicht muss.
Was man ja auch nicht sollte.
Es gibt eine Tatsache, über die wird nicht gerne berichtet, weil dann der ganze schöne Spannungsbogen, der so mühselig seit über einem Jahr gespannt wird, reißen würde. Die Tatsache lautet: Jörg Kachelmann wird nicht verurteilt werden.
Als der 3. Strafsenat des OLG Karlsruhe am 29. Juli 2010 der Haftbeschwerde Kachelmanns gegen seine seit dem 20. März andauernde Inhaftierung stattgab, begründete er das so, dass „die Fallkonstellation Aussage gegen Aussage“ vorliege, bei der Nebenklägerin „Bestrafungs- und Falschbelastungsmotive nicht ausgeschlossen werden könnten“, diese unzutreffende Angaben gemacht habe und eine „Selbstbeibringung“ der Verletzungen möglich sei.
Motive zur Lüge
Das Gericht wies also darauf hin, dass die Ex-Freundin Motive hatte zu lügen, die Verletzungen zweifelhaft waren und am Ende ihre Behauptung gegen seine Leugnung der Tat stehen würde. Zu einer anderen Einschätzung wird auch das Landgericht Mannheim nicht mehr kommen. Wenn – wie es jetzt aussieht – Ende dieses Monats das Urteil gesprochen wird, wird für den Angeklagten entschieden und Jörg Kachelmann freigesprochen werden. Zu Recht.
Hier soll es also um etwas anderes gehen. Um die mediale Grenzüberschreitung, die den Menschen ihr Ureigenstes nimmt: ihre Intimsphäre. Um die Liebe in Zeiten der Kamera.
Es gibt diesen Clip auf Youtube, in dem Jörg Kachelmann während der Wettermoderation von der Studiokatze überrascht wird. Sie streicht mit zur Begrüßung gerecktem Schwanz um seine Beine und er nimmt sie in den Arm und moderiert weiter. Der Clip, hochgeladen Anfang 2009, ist die reine Unschuld, Kachelmann ist noch bloß Kachelmann, eine Figur aus einer französischen Studentenkomödie, circa 1981, ein charmanter Taugenichts, hat was von einer Comicfigur wie dem tollpatschigen Gaston, steht einfach vor der Kamera rum und streichelt eine Katze, na, hey, du auch hier, fehlt bloß noch ein Grashalm, auf dem er rumkauen könnte.
In den Kommentaren unter dem Video ist natürlich längst die Wirklichkeit. „Und so einer soll jemanden vergewaltigt haben?“, fragt sich ChickenWing601, während SteveCrank in die Tasten tourettiert: „Hurensohn, Sado maso fetischist !!! Vergewaltiger Kinderrficker.“
Duchleuchtetes Intimleben
Nun, die Abertausend Artikel, die sich mit der Frage beschäftigen, ob er es nun getan hat oder nicht, sind nicht spurlos an den Leuten vorbeigegangen. Was nach der Verhaftung geschah und bis heute anhält, gab es vorher in Deutschland noch nie. Noch nie wurde das Intimleben eines Menschen so umfassend durchleuchtet, wurden die Details eines Lebens von einem ganzen Volk zerredet, bequatscht, verhöhnt, bis das ganze Leben selbst der Lächerlichkeit preisgegeben war. Oder doch eher: bis dem ganzen Menschen entzogen war, was nur ihm gehören soll.
Zunächst sickerte durch, dass Kachelmann weitere Freundinnen gehabt haben sollte. Dann wurden diese Freundinnen für Exklusivinterviews bezahlt. Was sie vor Gericht sagten, blieb der Öffentlichkeit verborgen, was sie also während stundenlanger Befragungen durch Meister der Befragung offenbarten – da war der Schutz des Gerichtssaals die letzte Bastion des Anstands.
Was sie aber den Gelegenheitsdenkern von der Bunten gegen reichlich Redegeld an Schmutz über den Mann, von dem sie sich enttäuscht fühlten, boten – das wurde zum Allgemeingut. Ein umfassendes psychologisches Profil schien zu entstehen. Wie er sie nannte, was er im Bett gern machte, über wen er was sagte, wie er roch, was er dachte. Erich Mielke dürfte über seine Lieblingsfußballer nicht so viel gewusst haben wie Patricia Riekel, die Bunte-Chefredakteurin, über Kachelmann zu wissen ihren Lesern vorgaukelte.
Vor Kurzem brauchte ich ein neues Bild für den Personalausweis, und während die Fotografin mich fotografierte, fing sie von Kachelmann an. Die, die am harmlosesten aussähen, erklärte sie mir, seien immer die schlimmsten. Ich versuchte, etwas böser zu schauen, um unverdächtig zu wirken.
Mafia-Logik der Bild-Zeitung
Wir schauen ab und an rüber zu den beiden Betroffenen, die zwischen ihren Gutachtern, Anwälten und Mediencoaches eingeklemmt miteinander ringen um irgendeine Form von Wahrheit und bilden uns ein, uns eine Meinung zu bilden, aber sie steht natürlich längst fest wie die von ChickenWing601 und SteveCrank. Für die Meinung von SteveCrank zuständig sind Bild und Bunte, Alice Schwarzer und Focus (und überraschenderweise auch das SZ-Magazin).
„Die gewohnheitsmäßigen und ekelerregenden Persönlichkeitsrechtsbrecher von Gnaden ihrer Herrin Friede Springer …“ Das twitterte Jörg Kachelmann am 10. April zusammen mit einem Bild, das er von einem Paparazzo, der ihn verfolgte, geschossen hatte. Hier wird jemand, bei dem das Gericht keinen dringenden Tatverdacht sieht, zur Strecke gebracht. Jemand, dem vonseiten des Rechts seine Intimsphäre zugestanden wird.
Für die Bild gilt vorgeblich das Diktum des Springer-Vorstandchefs Döpfner: „Wer mit ihr im Aufzug nach oben fährt, der fährt mit ihr im Aufzug nach unten.“ Was heißen soll: Wer mit uns Homestorys macht, um nach oben zu kommen, der bekommt uns auch nicht aus dem Wohnzimmer, wenn die Karriere schlingert und die Frau gerade die Koffer packt. Klingt fair, ist aber bloß Mafia-Logik: ein Quid pro Quo außerhalb des geltenden Rechts. „Wir beschützen Sie jetzt, bezahlen können Sie später.“
Kachelmann jedoch ist niemals mit Springer nach oben gefahren. Über sein Privatleben war vor seiner Verhaftung nichts bekannt, er galt im Allgemeinen als Wetter-Nerd, die Basler Zeitung fragte noch kurz nach der Verhaftung, ob Kachelmanns Privatleben überhaupt existiere. Stets habe er Nichtberufliches für sich behalten, seine Ehe sei „praktisch ein Geheimnis“ gewesen. Kein Grund, ihn nicht zu vernichten.
Weiter bei der Berliner Zeitung